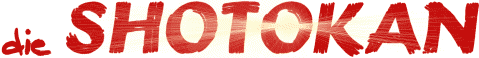|
RUBRIKEN
Was
ist ... ?
u.a.
Karate-Dô, Shotokan, JKA-Karate.
Grundsätzliche Fragen zu unserer Kampfkunst.
Wer
ist ... ?
u.a.
Gichin Funakoshi, Masatoshi Nakayama.
Die wichtigsten Meister in der Tradition des Shotokan-ryu.
Keiko
Der
Aufbau einer Übungsstunde im Shotokan-Karate.
Kihon
Das
Training grundliegender Fertigkeiten.
Kata
Das
Training überlieferter Formen bildet das Herz des Karate-Dô.
Kumite
Die
Anwendung von Karatetechniken mit einem Partner.
Gedichte
vom Weg
Die
Kunst das Unsagbare in Worte zu fassen.
Artikel
Wissenswertes
rund um das Shotokan-Karate-Dô.
Literatur
Eine
Auswahl empfehlenswerter Literatur mit Bezug zum Karate-Dô oder
den Kampfkünsten allgemein.
Links
Ein
Webwegweiser zu weiteren interessanten Seiten im Netz, die einen
Bezug zum Thema haben.
Newsletter
Wer
über Neuerungen auf dieser Seite informiert werden möchte, kann
sich hier für den Newsletter anmelden.
Gästebuch
Anregungen
und Meinungen zu dieser Seite. |

Ein in der Karate-Welt sehr umstrittenes
Thema ist die Frage nach dem Sinn und Nutzen von Wettkämpfen.
Geschichte
 Während die Geschichte des Karate-Dõ als
Kampfkunst jahrhundertealte Wurzeln hat, ist die Durchführung von sportlichen
Vergleichen in dieser Disziplin viel jüngeren Datums. Während die Geschichte des Karate-Dõ als
Kampfkunst jahrhundertealte Wurzeln hat, ist die Durchführung von sportlichen
Vergleichen in dieser Disziplin viel jüngeren Datums.
Gegen den Willen ihres "Ehrenvorsitzenden" Funakoshi-sensei
(dieser Titel wurde dem "Vater des modernen Karate" von vielen
verschiedenen Gruppierungen verliehen, ohne dass dies bedeuten würde, dass er
in einer besonderen Beziehung zu diesen stand!), führte die JKA erstmals 1956
eine alljapanische Meisterschaft durch. Vorausgegangen war die Entwicklung des Jiyu-kumite (freien Kämpfens) in Japan
zwischen den Weltkriegen. Während die Entwicklung des Jiyu-kumite sich im
wesentlichen aus der Adaption des okinawanischen Karate als nunmehr japanische
Kampfkunst erklären lässt, fand die Entwicklung des sportlichen Wettkampfes
offensichtlich im Hinblick auf die angestrebte internationale Verbreitung des Karate-Dõ
statt.
Im Ursprungsland Okinawa kannte man nur die
Übung der Kata und deren Anwendung, sowie das Training am Makiwara,
dem hölzernen Schlagpfosten. Entsprechend stießen die Entwicklungen in Japan
dort anfangs nur auf Verachtung und Spott (Trotzdem gibt es heute viele
okinawanische Stile, die auch Wettkämpfe abhalten).
Soweit es auf Okinawa zu Zweikämpfen kam, hatten diese nicht den Charakter von
fairen Vergleichen, sondern vielmehr von Duellen auf Leben und Tod.
Ebenso lehnten viele japanische Schüler
Funakoshi´s den Wettkampf ebenfalls ab, ohne sich aber dem Jiyu-kumite zu
verschliessen, so u.a. Shigeru Egami der legitime Nachfolger Funakoshi-sensei`s
als "chief instructor" des Shotokan genannten Dojo in Tokio und die
ihm folgende Shotokai-Gruppierung.
Die unterschiedlichen Positionen
 Im Zuge der weltweiten Verbreitung. anfänglich durch die JKA und später
auch durch anderer Meister und Verbände wurden diese gegensätzlichen
Positionen in der Welt verbreitet. Im Zuge der weltweiten Verbreitung. anfänglich durch die JKA und später
auch durch anderer Meister und Verbände wurden diese gegensätzlichen
Positionen in der Welt verbreitet.
Im Zuge der Entwicklung lassen sich drei unterschiedliche Standpunkte im
Hinblick auf die Zulassung von Wettkämpfen isolieren:
- Die klassische (orthodoxe) Strömung
lehnt weiterhin die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen als mit dem
Charakter des Karate-Dõ als Kampfkunst unvereinbar ab. Im Mittelpunkt des
Trainings steht nach wie vor die Übung der Kata und deren Anwendung.
- Die traditionelle (japanische) Strömung
folgt der Linie Nakayamas und der JKA. Wettkämpfe werden als ein
Bestandteil des Karate unter mehreren angesehen.
Der Erfolg im Wettkampf wird als Ergebnis des harten Trainings in Kihon,
Kata und grundliegenden Kumite-Formen angesehen (siehe auch das Interview
mit Safar-sensei).
Im Jiyu-kumite wird die Entscheidung mit der einen, alles entscheidenden
Technik gesucht (Ippon), die sich neben perfekter Distanz und Timing
insbesondere durch das Vorhandensein von Kime auszeichnet.
- Die sportliche Richtung
sieht den Wettkampf als Mittelpunkt des Karate an. Es werden in den
Disziplinen Kata und Kumite jeweils Spezialisten herangebildet, deren
Training einzig und allein auf den Wettkampferfolg ausgerichtet ist. Im
Mittelpunkt des Jiyu-kumite steht die Erzielung von Punkten, diesem Ziel
wird der Aspekt der Perfektionierung der Technik und insbesondere des Kime
untergeordnet. Das Ippon-Prinzip wurde zugunsten von Drei-Punkt-Kämpfen
fallengelassen. Neueste Tendenz ist wohl die Einführung eines
Rundensystems, so wie es im Boxen und Kickboxen üblich ist.
Gefahren
Bei nüchterner Betrachtung lassen sich in der Tat viele
Gefahren für die Entwicklung des Karate an sich ausmachen:
Wer sich einem Karate-Wettkampf und insbesondere einem Kumite-Wettkampf
stellt, der muss sich zunächst zuallererst darüber im Klaren sein, dass er
sich und seine Gesundheit einer großen Gefahr aussetzt. Denn Karate ist eine
Kampfkunst, bei der erhebliche Kräfte freigesetzt werden, die wenn sie
unkontrolliert eingesetzt werden erhebliche Verletzungen hervorrufen können.
Durch langandauerndes am Leistungssport orientiertes
"Wettkampftraining" setzt man seine Gelenke im übrigen einem
überdurchschnittlichen Verschleiß aus.
Sicherlich kann ein Wettkampf für einen jungen athletischen Menschen ein
motivierendes Erlebnis sein. Bei einem weniger talentierten oder älteren
Karateka, kann die Wirkung aber gerade entgegengesetzt sein. Die Betonung des
Wettkampfes als Schwerpunkt des Karate würde solche Menschen eher
abschrecken.
Ein weiteres Problem ist die Realitätsferne der Wettkampfsituation. Sie hat
nichts mit Selbstverteidigung zu tun, da beide Kontrahenten auf den Kampf
vorbereitet sind und sich mit gleichen Waffen gegenüberstehen. Da in dieser Art
von "Duell" nicht zugelassen werden kann, dass der Kampf bis zum
letzten geführt wird und eine eindeutige Entscheidung den Sieger bestimmt,
werden die Aktionen durch Schiedsrichter bewertet. Jeder, der einmal an einem
Kumite-Shiai teilgenommen hat, wird wissen, wie "ungerecht" solche
subjektiven Entscheidungen sein können. Nun ist es in Karate-Kreisen auch kein Geheimnis,
dass es mit der Unparteilichkeit vieler Schiedsrichter nicht so weit her ist ...
.
Der zählbare "Punkt" tritt an die Stelle der alles entscheidenden
Technik. "Ikken hissatsu" - "mit einem Schlag töten" war
ursprünglich der Mythos des Karate. Dieses Ideal der "Einen" Technik
erfordert das perfekte Zusammenwirken von Reaktion, Timing, Distanz und Kime. In
vielen Karate-Wettkämpfen hat sich aber hingegen das sogenannte "Punkte-denken"
durchgesetzt. Egal wie, Hauptsache der Gegner wird getroffen. Dies führt dazu,
dass die Geschwindigkeit mit der die Technik zum Ziel geführt wird eine
herausragende Position erhält. Der Einsatz des (langsameren) ganzen Körpers
wird zugunsten der (schnelleren) Extremitäten vernachlässigt. Die Idee des
Kime geht verloren.
Auch im Kata-Wettkampf sind vergleichbare Gefahren für die Entwicklung des
Karate erkennbar: Die Kata diente ursprünglich gerade der Herausbildung der
körperlichen Voraussetzung, um die eine, alles entscheidende Technik ausführen
zu können. Dazu bedarf es eines tiefen Verständnisses für Bedeutung und
Ausführung der einzelnen Elemente einer Kata. "Hito kata sannen" -
"Eine Kata drei Jahre" lautete ein Motto für die Übung der Kata auf
Okinawa. Die Vorführung einer Kata vor einem Publikum und vor Kampfrichtern hat
die Ausübung der Kata in den Jahren seit Einführung von Wettkämpfen
maßgeblich verändert. Die Kata-Vorführungen wurden schneller, dynamischer,
athletischer und theatralischer. "Höher - schneller - weiter" lautet
scheinbar ein Motto.
Doch die Hauptgefahr für die Entwicklung des Karate ist eine ganz
andere:
"Oberstes Ziel in der Kunst des Karate-Dõ ist nicht Sieg oder
Niederlage, sondern die Vervollkommnung des eigenen Charakters"
So formulierte es einst Nakayama-sensei, der Begründer der JKA und einer der
wesentlichen Förderer des Karate-Wettkampfes. Die Vervollkommnung des eigenen
Charakters bedeutet in den Kampfkünsten seit jeher, dass man sich selbst -
seinem Ego - auseinandersetzt. Im Budo ist der eigentliche Feind unser
eigenes schwaches Selbst, mit all seinen Schwächen und seiner
Unvollkommenheit. Durch hartes, entbehrungsreiches und manchmal auch
schmerzhaftes Training können wir Erfahrungen über uns selbst sammeln.
Auf der anderen Seite steht die Idee des Sports, das heißt, des Vergleichs mit
anderen. Wer sich erfolgreich mit anderen vergleicht läuft Gefahr, diesen
Erfolg misszuverstehen und sich selbst gegenüber anderen nicht so talentierten
Menschen zu überhöhen. Das Ego wird nicht bekämpft, sondern vielmehr
gefördert. Die den Kampfkünsten eigenen moralischen Werte, die in der Etikette
zum Ausdruck kommen, sind dann bedeutungslos. Wettkampfgehabe tritt an ihre
Stelle.
Auswertung
Nach der ganzen Aufzählung von Gefahren könnte man zu dem Schluss gelangen,
dass Wettkämpfe den Zielen des Karate-Do genau entgegengesetzt sind und daher
vollkommen abzulehnen sind.
Dieser Schluss ist aber von mir nicht gewollt. Vielmehr kann die genaue Kenntnis
von den möglichen negativen Auswirkungen helfen, Wettkämpfe zum Wohle des
Karate zu benutzen.
 Es lassen sich sehr wohl positive Aspekte isolieren: Es lassen sich sehr wohl positive Aspekte isolieren:
Die Ausübung einer Kampkunst bedeutet die Auseinandersetzung mit physischer und
psychischer Gewalteinwirkung. Beide Arten von Angriffen können uns nicht nur
körperlich verletzen, sondern vielmehr auch geistig aus der Bahn werfen. Der
letztgenannte Stress, der für uns in einer realen Konfliktsituation entsteht,
kann uns lähmen, zu Fehlern verleiten oder gar in Panik stürzen. Während sich
die Auswirkung körperlicher Aggression in Kumite-übung im Training leicht
simulieren lässt, ist dies für den physischen Stress ungleich schwieriger. Auf
Okinawa war es nicht gerade unüblich, die eigenen Techniken an betrunkenen
Raufbolden auszuprobieren und sich somit Gewissheit zu verschaffen.
Solche Methode sind aber hierzulande moralisch zweifelhaft und außerdem sogar
strafbar. Einziger Ausweg sind künstliche Stresssituationen. Die Teilnahme an
einem Wettkampf (ebenso wie eine Prüfung) kann einen Ersatz darstellen. Im
Mittelpunkt steht dann nicht das Erreichen der nächsten Runde, sondern die
Frage: Wie reagiere ich auf Stress?
Kann ich meine Kata unbeeindruckt von den äußeren Umständen aufführen? Lasse
ich mich von meinem Gegner im Kumite beeindrucken oder kann ich mich ganz auf
den Kampf konzentrieren?
So verstanden sind Wettkämpfe eine Auseinandersetzung mit dem Stressfaktor!
Natürlich empfindet es jeder als befriedigend, einen Kampf zu gewinnen, eine
Runde weiterzukommen oder gar als Sieger auf dem Treppchen zu stehen. Dies ist
aber nicht das Wesentliche! Wenn man seine innere Einstellung testet, muss man
für jede Niederlage dankbar sein. Etwaige "Fehlentscheidungen" von
Schiedsrichtern können uns nicht berühren, da sie unsere Zielsetzung nicht
gefährden können!
Wenn es nicht mehr primär um das Erzielen von Punkten und Gewinnen von Kämpfen
geht, braucht man auch kein spezielles Wettkampftraining. Wettkampf ist ein
Nebenprodukt. Die Leistungen, die dafür notwendig sind, fallen natürlich im
alltäglichen Training von Kihon, Kata und Kumite ab.
Dieses Verständnis von Wettkampf erlaubt die Durchführung von
hochkarätigen Veranstaltungen, die dem Karate äußerst förderlich sein
können. Dafür bedarf es aber, wie Safar-sensei in seinem Interview bereits
sagte dem Zusammenspiel von Aktiven, Instruktoren und Kampfrichtern. Gerade die
Instruktoren entscheiden nicht selten darüber, ob ihre Schützlinge den Blick
nach "innen" auf sich selbst richten oder aber vom Ehrgeiz verzehrt
werden. Die Aufgabe der Kampfrichter ist es der Versportlichung
entgegenzuwirken, sich nicht vom "höher - schneller - weiter" leiten
zu lassen. Darüber hinaus sollten sie gesteigerten Wert auf die Einhaltung der
Etikette legen, den Respekt vor dem Gegner zu fördern.
So gesehen macht es wenig Sinn, Karate-Wettkämpfe gänzlich abzulehnen. Denn
so sind sie tatsächlich eine Bereicherung und Ergänzung für das tägliche
Training.
(nach oben - zur
Übersicht zurück)
|